Von Thomas Bauer.
Eine Handvoll Touristen steht unschlüssig am Ufer der legendären Hafeneinfahrt von La Rochelle. Mal richten sie ihre Fotoapparate auf ein heimkehrendes Fischerboot, mal auf die Altstadtfront. Erst als ich an ihnen vorbeifahre, geht ein Ruck durch die Gruppe: Alle Kameras folgen mir. Zwei junge Männer stupsen ihre Partnerinnen an und zeigen mit dem Finger auf mich. Ich kann es ihnen nicht verdenken. Das Fahrzeug, auf dem ich unterwegs bin, ist ein dreieinhalb Meter langes, quietschgelbes Postfahrrad, an das sich ein einrädriger Anhänger anschließt. Dieser trägt, in einem ebenfalls leuchtend gelben Seesack verstaut, meinen Rucksack, fünfundvierzig Radwanderkarten, vier Liter Wasser und eine unvernünftige Menge Schokoladenkekse. So ausgerüstet beginnt meine Tour de France.
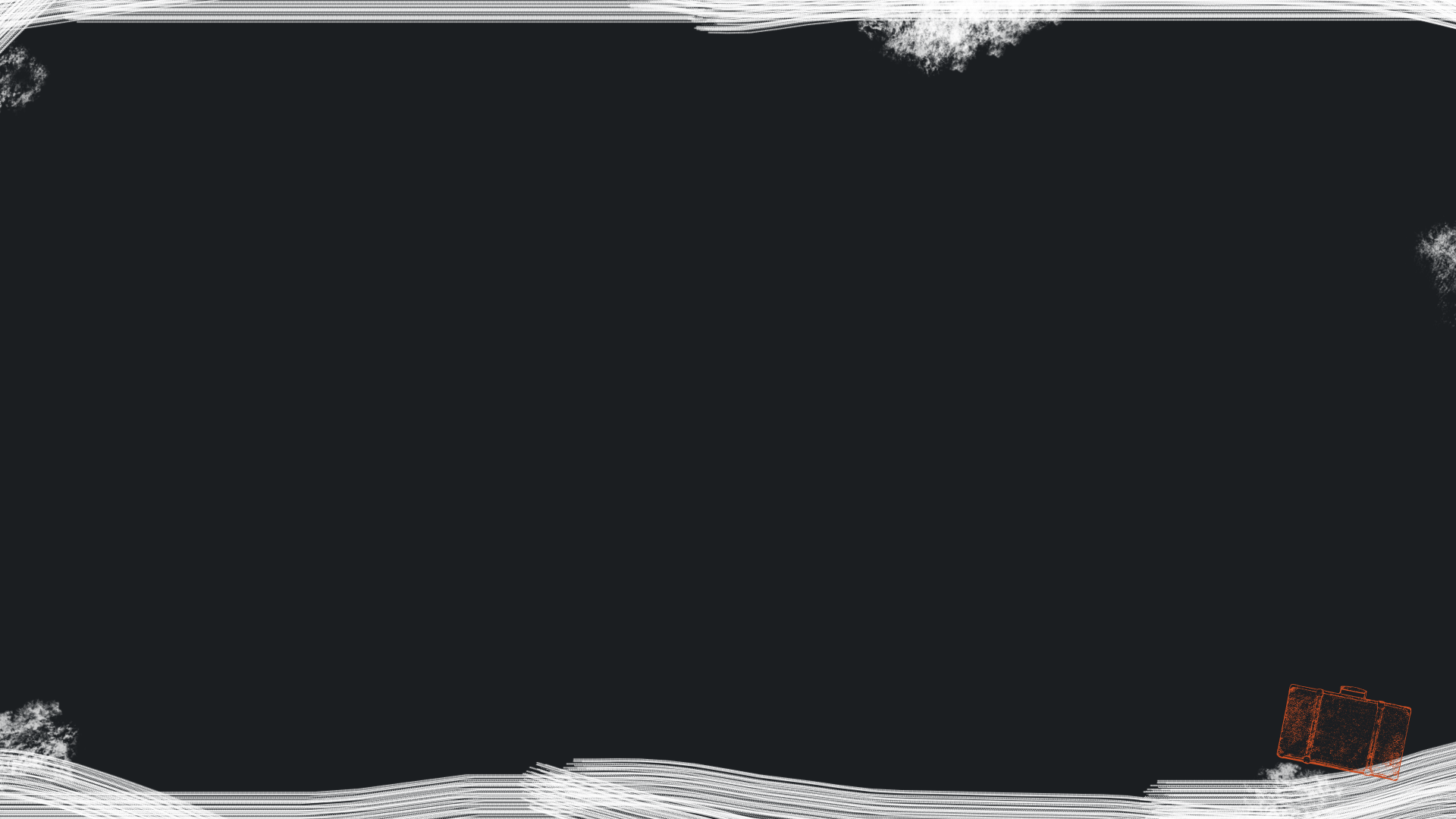

Der Autor
Thomas Bauer, 1976 in Stuttgart geboren, studierte in Konstanz, war Greenpeace-Mitarbeiter in Paris und Journalist in Sydney. Mittlerweile arbeitet er für das Goethe-Institut in München. Er lebt in Fellbach und in Tutzing.
Thomas Bauer umrundete Frankreich auf einem Postrad, fuhr per Fahrradrikscha von Laos nach Singapur, folgte der Donau im Paddelboot zum Schwarzen Meer, streifte ein Vierteljahr durch Südamerika, ging zweieinhalbtausend Kilometer auf Jakobswegen durch Europa, umrundete die japanische Pilgerinsel Shikoku, zog per Hundeschlitten durch Grönland und beobachtete im Himalaya einen der letzten Schneeleoparden. Zu seinen Büchern gehören „Nurbu – Im Reich des Schneeleoparden“, „Frankreich erfahren – Eine Umrundung per Postrad“ und „Die Gesichter Südamerikas“.
Weitere Informationen: www.neugier-auf-die-welt.de
Die Straße, die mich südwärts aus der Stadt bringt, heißt Avenue de Charles de Gaulle – was mich nicht wundert, da gefühlt etwa die Hälfte aller größeren Wege nach dem ersten Präsidenten der Fünften Republik benannt sind. Die andere Hälfte heißt Allée du Maréchal Foch, nach Ferdinand Foch, der nach dem Ersten Weltkrieg die Unterzeichnung des Waffenstillstands durch die Deutschen entgegengenommen hat.
Wie Pistolenkugeln schießen Autos an mir vorüber. Mit Getöse kündigen sich Lastwagen an, ehe sie so nah an mir vorbeibrausen, dass ich sie, hätte ich die Hand ausgestreckt, berühren hätte können. Über der schnurgeraden Straße flimmert die Hitze des Nachmittags. Von den vier Litern Wasser, die ich in La Rochelle gekauft habe, sind bald nur noch die leeren Flaschen übrig. Drei durchtrainierte Radfahrer überholen mich, ihre schicken Rennmaschinen glitzern in der Sonne. Der letzte lächelt mir aufmunternd zu, ehe er seinen Kameraden nachjagt. Einen Moment lang fühle ich mich in einen Werbespot für Yogurette oder Milchschnitte versetzt – und ich bin der tumbe Verlierer, der noch immer auf herkömmliche Schokolade setzt. Oder, in meinem Fall, auf ein vierzig Kilogramm schweres Postrad statt auf eine durchgestylte Federleichtmaschine.
Als sich der erste Supermarkt von Royan in mein Blickfeld schiebt, bringe ich mein quietschgelbes Gefährt vor der Eingangstür zum Stehen und hechte ins Innere. Augenblicklich sinkt die Temperatur um zwanzig Grad. Ich kaufe zwei Liter Wasser, einen Liter Trinkschokolade, einen Brotlaib, einen halb zerflossenen Brie, einen ganz zerflossenen Camembert und eine Packung Kekse, setze mich auf eine nahe Bank und verzehre alles vor den Augen zunehmend erstaunter Passanten. Acht Kilometer weiter, in der Nähe von Soulac, fängt mich das Schild eines Campingplatzes ein, das damit wirbt, dass heute Abend „garantiert kein Karaoke“ abgehalten werde.
Die ersten anderthalb Wochen meiner Reise waren eine Aufwärmübung für das, was mich am Nordrand der Pyrenäen erwartet. Dort legt mir die Strecke täglich neue Anstiege in den Weg. Mein Wasserverbrauch steigt auf sieben Liter pro Tag. Das T-Shirt haftet wie eine zweite Haut am Körper. An meinem ersten Tag im Baskenland presst mich die Sonne aus wie eine reife Orange, als ich mich an einer Anhöhe abmühe und direkt dahinter zu meiner Überraschung auf einen Haufen auf- und abspringender Menschen treffe. Weit ausholend schlagen sie auf Trommeln ein, die sie um die Hüfte gebunden haben. Männer, Frauen, Kinder laufen ungeordnet durcheinander, dazwischen huschen Hunde in entstehende Lücken. Gerade frage ich mich, ob ich an einem Sommerfest teilnehme oder ohne mein Wissen für die Loslösung des Baskenlands von Frankreich demonstriere, als ein weißhaariges, spindeldürres Männchen wie ein Wurfgeschoss von einem Tross tanzender Männer zur Seite geschleudert wird und mit voller Wucht in meine linke Flanke prallt.
„Aïe, faut faire gaffe, putain!”, schreit er den feierwütigen Jugendlichen hinterher, was an dieser Stelle unübersetzt bleiben soll, mir jedoch augenblicklich klarmacht, dass ich mit meinem Französisch bei ihm weiterkomme.
„Versuchen Sie erst mal, ein Postrad hier hindurchzuschieben”, merke ich an, als wir unsere Seiten massieren, er seine rechte, ich meine linke.
„Mein Gott, wohin wollen Sie denn mit diesem Ding?“
„Einmal um Frankreich herum. Ich bin schon so oft hier gewesen – in La Rochelle, Le Puy und Lorient, in Metz, Narbonne und Orléans, in Paris, Pau und Perpignan – dass ich Frankreich inzwischen besser kenne als Deutschland. Doch je öfter ich herkomme, desto weniger weiß ich von eurem Land! Darum will ich es dieses Mal anders kennenlernen, von seinen Rändern her. Was feiert ihr da eigentlich?”
„Keine Ahnung”, sagt er reflexartig, um sofort darauf loszuprusten. „Mann, ich weiß es wirklich nicht! Es gibt bestimmt einen Anlass für das hier. Aber soweit ich mich erinnere, ist es seit siebenundzwanzig Jahren halt so, dass der Bürgermeister zum Fest einlädt, und alle machen mit.”
Die Franzosen haben sie also nicht verloren, denke ich erleichtert, die Augenblicksbezogenheit und die Gabe, aus den Umständen das Beste zu machen, die mich noch bei jedem meiner bislang vierzig Frankreichaufenthalte beeindruckt hat! Meine stetig wachsende Leidenschaft für alles Französische hat mir manche Diskussion mit kulturgeschockten Frankreichbesuchern eingebracht, die von der vermeintlichen Arroganz der Franzosen abgeschreckt wurden. Ein nicht geringer Teil von mir findet sich nämlich im Spielerischen und im (Lebens-)Künstlerischen wieder, das man gern mit den Franzosen assoziiert. Und, ja: auch in der eigenbrötlerischen Schrulligkeit vieler Franzosen, dem zur Schau gestellten Individualismus und dem abgehobenen Künstlertum. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass es Frankreich in Zeiten, in denen der Massentourismus längst exotischere Ziele wie Marokko und Thailand bevorzugt, nicht länger mit spielerischer Lässigkeit schafft, sich als Mekka aller kultivierten Genussmenschen zu präsentieren. Im Land selbst rangieren inzwischen sogar die Ungarn in Sachen Liebeskunst vor den eigenen Einwohnern. Die Ungarn!
Die Lust am Fabulieren und der Hang zur gezielten Übertreibung sind den Franzosen aber geblieben. Frankreichgeschädigte mögen anmerken, dass es gerade darum kein Wunder ist, dass ausgerechnet der Hahn zum Nationalsymbol des Landes avanciert ist, ein Tier also, das sich gern aufplustert und auch dann lauthals kräht, wenn es mit beiden Beinen im Mist steht. Aber, im Ernst: Wer verzeiht das den Franzosen nicht, wenn er, wie ich, gerade in einer der schönsten Ecken Südfrankreichs unterwegs ist? Von den Bergspitzen der Pyrenäen, die sich halbkreisförmig im Südosten aufgestellt haben, scheinen Schneefelder Morsezeichen herabzublinken. Darüber sind Andeutungen von Wolken fein wie Zuckerwatte in den Himmel gestreut. Kirchturmspitzen lugen neugierig aus Talmulden, in denen sich reizende Dörfchen und ausgedehnte Gehöfte verstecken. Ich kann meinen Blick kaum von der Landschaft lösen.
Kurz vor Oloron-Sainte-Marie stürzt die Straße der Stadt entgegen und katapultiert mich direkt vor eine Herberge. Dort suche ich das hauseigene Restaurant auf – und treffe auf eine alte Bekannte!
Es war Liebe auf den ersten Blick, als wir das erste Mal in einer bretonischen Küstenkneipe aufeinandertrafen. Zuerst fand ich sie – ich war ja so jung! – einfach nur süß. Dann aber offenbarte sie mir nach und nach ihr wahres Wesen, vertraute mir mehrere Geheimnisse an und stürzte mich in eine lang anhaltende Sehnsucht, die mich, wenn ich ehrlich bin, bis heute nicht losgelassen hat. Zuweilen ertappe ich mich gar bei dem Gedanken, dass mich all die Anderen, auf die ich mich nach jener denkwürdigen Begegnung eingelassen habe, in Wahrheit nur an jenen Abend erinnern sollten. Und doch können sie niemals mehr sein als ein schaler Abklatsch, unfähig, mich auch nur in die Nähe der Intensität jenes ersten Mals zu führen.
Île flottante, „treibende Insel“, nennt sich die Köstlichkeit, von der hier die Rede ist. Ich war sechseinhalb, als wir uns begegneten. Der bretonische Kellner wusste nicht, was er auslöste, als er nach geglücktem Hauptgang einen tiefen Teller mit Vanillesoße vor mich stellte, aus dem ein kleiner Berg aus geschlagenem Eiweiß und reichlich Zucker ragte. Sorgsam darauf bedacht, den Löffel jeweils höchstens halb zu füllen, schiebe ich mir wie damals in der Bretagne die perfekte Mischung aus Eiweiß und Vanillesoße in den Mund und schlucke das Ganze schließlich mit dem Ausdruck höchsten Entzückens hinunter. Statt Straßen und Plätze nach Kriegsherren zu benennen, hätten die Franzosen so viele echte Helden zur Auswahl, die der Menschheit wahre Dienste erwiesen haben, denke ich, als wirklich kein Tropfen Soße mehr aus dem Teller herauszuholen ist. Der Kellner scheint meiner Meinung zu sein. Verständnisvoll zwinkert er mir zu, als er unaufgefordert eine zweite Portion „schwimmende Insel“ auf den Tisch stellt.
Leider sind in Frankreich nicht alle Mahlzeiten ein kulinarischer Hochgenuss. Genau wie die Liebesbereitschaft der Damen, der Baguettekonsum und die Anzahl der Baskenmützen wird auch die Qualität des französischen Frühstücks gern überschätzt. Meist reicht man mir morgens nur zwei Scheiben Toastbrot, ein Flugzeugpäckchen Butter und einen Klecks Marmelade zu einem wässrigen Kaffee oder einer dickflüssigen Schokolade. Vielleicht liegt die Lösung, aus diesen knapp bemessenen Zutaten etwas Brauchbares herzustellen, ja wirklich in der Eigenart der Franzosen, den bestrichenen Toast so lange ins Getränk zu tunken, bis er sich in eine klebrige, schwammartige Masse verwandelt hat und eine feine Schicht aus Fett und Marmelade an der Oberfläche des Getränks schwimmt. Ich bringe das schlichtweg nicht fertig.
Als ich Apt erreiche, fällt mir augenblicklich auf, dass hier eine andere Stimmung herrscht als auf meiner bisherigen Reise. Schon am frühen Abend kriechen die Schatten der Berge auf die Stadt zu. Deren Bewohner gehen mit weit ausholenden, federnden Schritten vorwärts. Die wenigen Gäste ähneln Hochleistungssportlern und berichten vorzugsweise von Bergüberquerungen in Rekordzeit. Selbst im August stellen die Cafés Wärmestrahler nach draußen. Die Luft wirkt, als habe man sie in den Tälern zusammengepresst und hier komprimiert wieder freigelassen. Seit ich das Département Bouches-du-Rhône verlassen und die Vaucluse erreicht habe, fühle ich mich zum ersten Mal auf meiner Reise fernab des Meeres. In Apt bin ich unbestreitbar in den Bergen angekommen – auch wenn das Städtchen von Obstplantagen umgeben und für seine kandierten Früchte bekannt ist.
Von hier an steigt die Wegstrecke stetig bergan. Ein col, Pass, folgt dem nächsten, bis ich das Wort in Gedanken zu colère, Wut, vervollständige. Die Zeit zieht sich wie Kaugummi in die Länge, als wären die Uhrzeiger bei ihrem Dauerlauf ins Stocken geraten. Fast kommt es mir vor, als führe ich in einem Wurmloch bergauf, immer bergauf, schwitzend trotz des kalten Windes, der mir nach wie vor stramm entgegenbläst, keuchend trotz der glasklaren Luft, in die sich der Duft Dutzender Lavendelteppiche legt, und umgeben von den Reizen, die die Vaucluse großzügig verschenkt.

© Thomas Bauer
Abgesehen von grandiosen Ausblicken in farbgesättigte Täler hinein gibt mir die Strecke keine Anhaltspunkte an die Hand. Keine Stadt, kein markanter Punkt teilt mir mit, wie lange es noch dauern mag, ehe ich mein heutiges Etappenziel erreiche. Mit jeder Stunde, in der ich auf Sault zukrieche, malt sich meine Fantasie dieses Bergdorf größer und schillernder aus. Auf sechshundert Metern über dem Meeresspiegel hat sie bereits eine ansehnliche Stadt gezeichnet. Zweihundert Meter höher hat sie einen von der Dorfjugend lässig drapierten, mittelalterlich anmutenden Hauptplatz entworfen, auf dem zwei bärtige Straßenmusiker, die erschreckend an die Wildecker Herzbuben erinnern, folkloristische Lieder über die Lust am Bergsteigen zum Besten geben. Eine Stunde später hat sie eine Schlemmergasse samt anheimelndem Hotel für müde Postradfahrer und andere Verrückte angelegt.
Die Realität übertrifft jedoch alle Skizzen meiner Fantasie um ein Vielfaches. Unvermittelt fällt die Steigung der Straße in sich zusammen, sodass ich entspannt auf den zentralen Platz von Sault rollen kann. Direkt dahinter, von einer steinernen Mauer notdürftig verdeckt, stürzt die Landschaft jäh ab und breitet sich hunderte Meter tiefer in den intensivsten Farben aus, bis sie an die Gebirgskette der Alpen stößt, die das Gebiet von West nach Ost durchzieht. Das satte Lila der Lavendelfelder, pointilistisch in die Landschaft gemalt, wird auf das Feinste unterbrochen vom leuchtenden Ocker rechteckiger Getreideflächen, die ein Mähdrescher aberntet. In dieses Meer aus Buntheit hinein sind Gehöfte gesetzt, deren klar gezogene Konturen die Illusion von Nähe erzeugen. Meine Augen können sich nicht satt sehen an diesen von Farben durchfluteten Flächen, die der Mistral ständig in Bewegung hält. Es ist, als blicke man aus dem Ausguck eines Dreimasters hinaus auf den wogenden Ozean.
Zahlreiche Hobbymaler, in Reih und Glied an der Steinmauer aufgestellt, versuchen, dem privilegierten Blick gerecht zu werden, indem sie die unter ihnen liegende Landschaft auf einem Stück Leinwand komprimiert darstellen. Trotzdem liegen Welten zwischen dem Original und den Abbildern, was kein Wunder ist: Kaum hat man einen Pinselstrich beendet, ist einem der Wind auch schon in die Parade gefahren. Er hat Details neu angeordnet, Getreidehalme und Lavendelspitzen in neue Richtungen gedreht. Welcher Moment ist der richtige? Der jetzige oder jener in fünf Sekunden? Für welchen entscheidet man sich? Wie will man es überhaupt anstellen, die Bewegung, die in alldem ist, in einem statischen Bild einzufangen?
Die Etappe, die ich wenige Tage später in Angriff nehme, ist eigentlich ein Hüpfer von etwa siebzig Kilometern von Bourg-en-Bresse nach Lons-le-Saunier, den ich bei günstigen Bedingungen in viereinhalb Stunden bewältigen kann. Sie ist jedoch gleichzeitig in ihrer geografischen und emotionalen Bedeutung kaum zu überschätzen. Denn irgendwo hier, zwischen Bourg-en-Bresse und Lons-le-Saunier, verläuft die gedachte Grenze, die das nicht real existierende, aber umso intensiver gefühlte Südfrankreich vom ebenso irrealen, aber nicht minder heftig erlebten Nordfrankreich trennt.
Südlich dieser Linie räkeln sich in der französischen Vorstellungswelt die Begünstigten des Lebens auf langgezogenen Sandstränden, lustwandeln Künstler und Geistesgrößen unter Platanen, blicken Touristen voller Sehnsucht wogende Lavendelfelder entlang. Das Leben ist heiter und beschwingt, überstrahlt von einer gütig lächelnden Sonne, weshalb auf manchen französischen Wetterkarten der Süden von Vornherein mit einem freundlich hellen Zitronengelb hinterlegt ist. Die Nordhälfte des Hexagons ist dagegen auf denselben Karten in einem ungünstigen Grauton gehalten. Allzu nah sind hier oben die als kalt empfundenen Länder Deutschland, Belgien und die Schweiz, gefürchtet sind die launischen Winde und ergiebigen Regengüsse der Normandie und der Bretagne, berüchtigt ist das wurst- und sauerkrautlastige Essen Nordostfrankreichs. Misstrauisch nehmen Südfranzosen die Kunde auf, dass sich das Leben hier oben zum Großteil in den eigenen vier Wänden statt draußen abspielt, dass die Bewohner diszipliniert sind und zuweilen gar Regeln einhalten.
In Wahrheit gibt es eine solche Grenze zwischen Nord- und Südfrankreich natürlich nicht, und die nördlichen Regionen werden in Zukunft weit mehr Touristen anlocken als bisher. Ihre Naturschätze, Wanderwege und Radstreckennetze, Städte wie Besançon, Mulhouse, Lille und das Versprechen, nachts schlafen zu können, statt im eigenen Schweiß wach zu liegen, bürgen dafür. Regionen wie die Franche-Comté haben gerade erst begonnen, ihr touristisches Potenzial zu nutzen.
Einstweilen jedoch ist sie noch allgegenwärtig, die südfranzösische Einstellung gegenüber dem Norden, die Dany Boon in seinem meisterhaften Film Willkommen bei den Sch’tis so gekonnt auf die Spitze treibt. Dort trifft ein ins Nord-Pas-de-Calais strafversetzter Südländer auf einen alten Mann, der ihn tatsächlich erlebt hat, den Norden Frankreichs. Und was erzählt er ihm darüber? „Man stirbt dort jung … Im Sommer geht’s noch, da hat’s um null Grad. Aber im Winter werden es minus zehn, minus zwanzig, minus dreißig … dann bleibst du besser zuhause, ehe es minus vierzig Grad werden …“ – „Minus vierzig Grad?“ – „Ist eben der Norden!“
Dieses so ironisch wie genial entlarvte Vorurteil betrifft die Gegend nördlich von Lille, die sich weit, weit jenseits der Vorstellungskraft vieler Südfranzosen befindet. Die Regionen dort oben gehören aus jener Sicht ja schon fast zu Großbritannien und sind damit so etwas wie die Vorstufe zur totalen Barbarei. Die Franche-Comté, in die ich nach Überschreiten der gedachten innerfranzösischen Grenze gekommen bin, wird zwar als dem Norden zugehörige Region ebenfalls misstrauisch beäugt, punktet jedoch immerhin mit dem gleichnamigen Rohmilchkäse – ein subtiles Indiz für zivilisatorische Ansätze.
In Lons-le-Saunier finde ich auf Anhieb ein Hotel am Stadtrand, das trotz des günstigen Preises mit allerhand ausgeklügelten Extras aufwartet, die man anderswo weder erwartet noch vorfindet. Da ist beispielsweise das kostenfreie Zusatzangebot Am Puls der Zeit, das darin besteht, dass man jede Diskussion der Zimmernachbarn zur Rechten und zur Linken hautnah miterlebt, da die Wände kaum dicker als ein Stück Wellpappe sind. Meine linke Nachbarin hat das mitgebrachte Radio aufgedreht, um trotz ihrer offensichtlichen Schwerhörigkeit die Hits der Neunzigerjahre mitsingen zu können, während sich zu meiner Rechten ein streitlustiges Pärchen eingenistet hat. Das Zimmer selbst weist eine nicht zu leugnende Vorliebe für den chaotischen Kunststil Jackson Pollocks auf, dem man mit vielfarbigen, zuweilen ins Rauminnere ragenden Tapetenfetzen huldigt. Auf diese Weise kommen die eindrucksvollen Kunstwerke besonders gut zum Ausdruck, die der Schimmel in weißen, schattengrauen und tiefschwarzen Farben an die Wände gemalt hat – umso dunkler, je näher die lebenden Ausstellungsstücke der lecken Leitung kommen, die sich hinter der Wand quer durchs Zimmer zieht. Eine weitere Überraschung für den Gast ist der Fernseher Snow, der jeder Sendung eine romantische Grundstimmung verleiht, da er alle Programme mit einer beinahe schon kitschigen Schneelandschaft hinterlegt. Der eigentliche Clou der Unterkunft ist jedoch die integrierte Wetterstation, die niemals falsch liegt: Um zu testen, woher der Wind weht oder ob es regnet, muss ich lediglich meinen Arm durch das doppelt faustgroße Loch in der Wand stecken, das direkt nach draußen führt. Der Inhaber dieser Nobelbaracke sollte sich seine Extras patentieren lassen.
Als ich mein Postrad wenige Tage später westlich aus Rouen lenke, fühle ich mich in den späten Abend versetzt, obwohl es noch früh am Mittag ist. Das Sonnenlicht besitzt in Nordfrankreich keinen klaren Fokus; es umhüllt Dinge eher, statt sie zu erhellen. Aber trotzdem: Ist das hier noch Rouen, ist das noch die Normandie, oder bereits Mordor, das dunkle Schreckensreich aus Der Herr der Ringe? Parallel zu den rostigen Schienen eines Industriegebiets, auf denen Güterzüge entlangkriechen, folge ich dem Verlauf einer pitschnassen Asphaltstraße. Überall um mich herum verpesten Fabrikanlagen die Luft. Das Gehupe der Lastwagen bringt das Postrad unter mir zum Beben, die Güterzüge schreien in jeder Kurve auf, als fahre ein Riese mit Kreide über eine gigantische Schreibtafel. Zu allem Überfluss sammeln direkt über mir pechschwarze Wolken Energie für eine Entladung von Kraft und Wut.
Just in diesem Moment bahnt sich die Katastrophe an. Ein Lastwagen überholt mich noch etwas dichter als seine Vorgänger. Ich spüre, wie mein linker Ellbogen auf hartes Metall stößt, und reiße vor Schreck den Lenker meines Postrads nach rechts. Noch während ich über den ungewöhnlich hohen Bordstein rumpele, fällt mein Blick auf die direkt dahinterliegenden Glasscherben. Einen absurden Augenblick lang genieße ich die Sicht auf die scharfkantigen Kunstwerke, die den Boden sprenkeln. Gewaltige Wolken spiegeln sich darin wie die Nacht selbst – als sei Darth Vader allzu nah an einen zerbrochenen Spiegel getreten. Gleichzeitig weiß ich, dass es bereits zu spät zum Ausweichen ist. Mit allen drei Rädern fahre ich direkt in den Scherbenhaufen hinein.
Ich höre ein entsetzliches Knirschen unter mir und sofort darauf ein lautes Pffft, einer Lokomotive gleich, die in der Ferne Dampf ablässt. Glas stiebt nach allen Seiten davon. Meine Hände krallen sich um die Bremse. Ich lasse ein gutes Zehntel meiner Reifenmäntel als spektakuläre Gummispur auf der Straße zurück und komme vier Meter hinter dem Tatort zum Stehen. Dort stoße ich einen international verständlichen Fluch aus, steige ab und öffne meinen Rucksack, um an das Flickzeug zu gelangen.
Das gibt’s doch nicht! Meine Funktionskleidung, mein treues Minizelt, der speziell für diese Reise erworbene Schlafsack, der heute Vormittag aufgefüllte Proviant: All das schwimmt in einer zähen Suppe aus Wasser, das eine böse Koalition mit dem Schmutz der vergangenen fünf Wochen eingegangen ist. Halb aufgelöste Brot- und Käsereste, Ölrückstände und Kugelschreiber treiben darin umher. Vermutlich habe ich den Zwischenfall meinem allzu ruckligen Satz über den Bordstein zu verdanken. Erneut fluche ich wie ein Rohrspatz, dieses Mal auf Französisch, was eindeutig besser klingt, mir aber leider auch nicht weiterhilft.
Es bleibt mir nichts anderes übrig, als meine Siebensachen zurück in den Rucksack zu stopfen und mein Postrad anschließend durch das Industriegebiet zu schieben – zurück in die Innenstadt von Rouen. Als ich gerade die ersten beiden Schritte getan habe, wirft mich die Wucht eines Donnerhalls beinahe zu Boden. Einen Wimpernschlag später bricht aus den Wolkengebirgen über mir ein Niederschlag heraus, der seinem Namen alle Ehre macht. Wie eine Wand stürzt der Regen auf die Erde herab. Keine Minute später bin ich durch die Jacke, den Pullover und das T-Shirt hindurch nass. Regenfäden seilen sich meinen Rücken hinab, Rinnsale kriechen in meine Achseln. Vier Stunden Fußmarsch liegen vor mir. Reisen „wie Gott in Frankreich” sieht anders aus.
Genau in diesem Moment aber erwacht ein kindlicher Trotz in mir. Wer bin ich eigentlich, dass ich mich von einer blöden Regenwolke aufhalten lasse? Ich merke erstaunt, dass ich schwungvoller ausschreite. Nach einem Dutzend Querstraßen und drei Abzweigungen gelange ich zu einem Geschäft, über dessen Eingang ein elegantes Mountainbike gemalt ist. Dort würde ich einen Ersatzschlauch finden. Hallo mein Schutzengel, denke ich noch, ehe ich in den Laden hechte, wie schön, dass du wieder im Dienst bist.
Ähnlich wie in Rouen ist es mir auf meiner Tour de France oft ergangen. Kein Wunder; ich suche ja bewusst den Kontrollverlust und empfinde es als befreiend, dass ich mittags nicht weiß, wo ich abends sein werde. Ich gebe den Dingen die Gelegenheit, mich zu überraschen, und das ist vermutlich eine sehr französische Art zu reisen. In den zurückliegenden sechseinhalb Wochen habe ich das getan, was vielleicht die französischste aller Eigenschaften ist: Se débrouiller nennt sie sich, unter Jugendlichen auch als système D bekannt. Die deutsche Entsprechung „sich durchwursteln“ beschreibt den Sachverhalt unzureichend; ihr fehlt jener anerkennende Unterton, der auf die Leistung der Lebenskünstler verweist. Solchen Gedanken nachhängend, fahre ich am letzten Tag meiner Frankreichumrundung südwärts, bis eine Insel im Atlantik auftaucht, die über eine gigantische Brücke mit dem Festland verbunden ist. Am diesseitigen Ufer kann ich die ersten Dächer einer Großstadt erkennen. La Rochelle!
Von diesem Anblick angespornt, brause ich voran, als hätte ich mich in einen quietschgelben Eisenspan verwandelt und würde von einem überdimensionierten Magneten angezogen. Ich fliege dem Ausgangspunkt und Endziel meiner Tour de France regelrecht entgegen. Wenig später falle ich La Rochelle in die Arme. Als ich das Ortsschild passiere, nehme ich die Hände vom Lenker, schicke das Postrad unter mir auf einen Schlingerkurs und gebe Ausrufe des Entzückens zum Besten, bis sich eine ältere Dame der Kategorie PPH, passera pas l’hiver („wird den Winter nicht überstehen”), mehrmals an die Stirn tippt.
Ein Radwegsystem führt mich kurz darauf durch die lang gezogenen Grünanlagen der Stadt und setzt mich schließlich auf dem Areal des alten Hafens ab, wo meine abenteuerliche Frankreichumrundung vor sieben Wochen ihren Ausgang genommen hat. Ich habe acht Kilogramm Körpergewicht und einige Vorurteile gegenüber den Franzosen verloren, unzählige Bekanntschaften gemacht und Orte aufgesucht, deren Namen ich bis heute nicht aussprechen kann. Frankreich habe ich als Mosaik unterschiedlichster Traditionen, Mentalitäten und Dialekte kennengelernt.
Was eint diesen Flickenteppich? Vielleicht nur ein Gefühl, eine Lebenseinstellung: Sie besagt, dass man, statt verbissen und effizient einem Ziel hinterherzujagen, auch darauf bedacht sein darf, den eigenen, sich ständig ändernden Weg dorthin zu genießen. Seit jeher gilt meine Sympathie den verschrobenen, in der falschen Zeit umherirrenden Lebenskünstlern, die sich diese Devise zu Eigen machen.
Einer dieser Lebenskünstler ist soeben mit einem Postrad um Frankreich herumgefahren. Manchmal, in Ausnahmefällen, behalten die Traumtänzer recht.

