Ich ziehe durch das Labyrinth der engen Gassen und Treppen der Favela, meiner neuen Heimat. Wie heißt es auf der Website des Auswärtigen Amtes in Berlin: »Von Favela-Besuchen wird dringend abgeraten.« In »meiner« Favela trainieren die UNO-Friedenstruppen für den Häuserkampf, habe ich mittlerweile erfahren. Es sieht gefährlich aus, wie in einem Film – und tatsächlich ist es eine Filmkulisse. Brasilianische Seifenopern wurden hier gedreht, und im Jahr 2007 der Spielfilm Der unglaubliche Hulk. Spezialeinheiten jagten das grüne Ungeheuer durch die Gassen von Tavares Bastos – fast wie einige Jahre vorher im echten Leben Sonderpolizisten die Drogengangster. Doch das Grauen zeigt sich von der netten Seite. Alle grüßen sich gegenseitig, wie in Brasilien üblich mit erhobenem Daumen, oi, und noch kumpelhafter oba, »hallo«, oder am Morgen bom dia (ausgesprochen »bong dschia«), am Nachmittag boa tarde (ausgesprochen »boa tardschi«, von den Leuten hier verkürzt zu boa ta’) und nach Einbruch der Dunkelheit boa noite (ausgesprochen »boa noitschi«, verkürzt »boa noitsch«). Die schmalen Gassen mit ihren grauen Häusern erinnern mich an die Hutongs, die zum Teil ähnlich engen und verwinkelten Gassen im Zentrum von Peking. Allerdings sind die Häuser dort alle einstöckig, hier wurde auch zwei-, drei- und vierstöckig gebaut. Auch sind die Hutongs viel älter, sie gehen auf die Eroberung Chinas durch die Mongolen unter Dschingis Khan im Jahr 1215 zurück. Doch in Hutongs wie in Favelas leben Stadtbewohner wie in einem Dorf zusammen, kennen und grüßen sich gegenseitig. Und sowohl in China als auch in Brasilien interessieren sich Künstler und andere Intellektuelle zunehmend für diese Lebensform und Rio real 71 ziehen in die einfachen Siedlungen – in beiden Ländern auch Ausländer. Wie in einem Dorf gackern sogar Hühner durch die Gassen. Eines Morgens kräht ein Hahn mit wunderschönen grünen Federn vor meiner Tür. Wohlgemerkt, ich lebe in Rio de Janeiro, einer Metropole mit mehr als sechs Millionen Einwohnern. Mit Blick auf die Skyline der »wunderbaren Stadt«, den Zuckerhut und den Atlantik rufe ich meine Mutter per Skype aus der Favela an. Ihre erste Frage: »Sind die Häuser dort stabil? Rutschen die nicht bei Regen den Hang hinunter?« Gute Frage, denn sie führt zu einem weiteren Punkt, der sich in den Favelas verändert: Als sie entstanden, nagelten die Neuankömmlinge Hütten aus Brettern und Wellblech zusammen. Heute ist hier alles gemauert aus Backstein und Beton, wie ich erzählt habe sogar das Bett, das damit deutlich stabiler steht als der Bastelbausatz von Ikea, den ich in Hamburg benutzte. Aber mir ist auch klar: Favela ist nicht gleich Favela. Schließlich war ich mit dem Niederländer Nanko van Buuren in der Favela Vila Cruzeiro, wo viele Häuser bei einem Erdrutsch zerstört wurden und Familien zu Tode kamen.
Brasilien Brennt
Dieser Text ist ein Auszug aus dem Buch “Brasilien brennt” von Adrian Geiges.
- Quadriga Verlag
- ISBN: 978-3869950631
- Auch als E-Book erhältlich
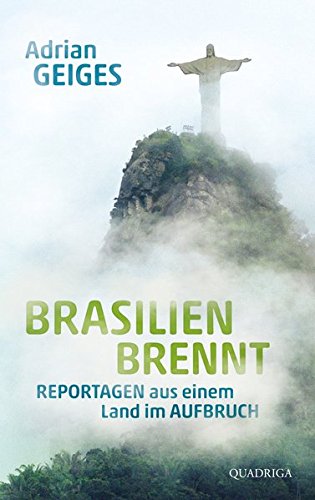
Direkt hinter meinem Haus führt eine steile Treppe zwischen den Häusern nach unten. Ein schwarzer Retriever liegt vor einer Tür. Normalerweise fürchte ich mich vor Hunden. Doch hier sind sie nicht zu aggressiven Wachhunden erzogen worden, sie leben friedlich zwischen den Menschen. Die Stufen enden an einem Gittertor. Ich höre Schreie. Als ich das Tor öffne, finde ich mich auf einem Sportplatz wieder. Mädchen und Jungen spreizen ihre Beine und strecken eine Hand nach vorne, trainieren mit einem Lehrer Karate. Sport spielt eine wichtige Rolle bei dem Projekt, den Kindern aus den Favelas eine Zukunft zu eröffnen. Auf einem Spruchband steht: »Unterstützt von der Gemeinschaft Tavares Bastos und der Eliteeinheit BOPE«. Einwohner und Polizei verstehen sich hier nicht als Feinde, sondern als Partner. Das Ausgangstor des Sportplatzes führt durch eine weitere enge Gasse mit Treppenstufen zu einem Platz, auf dem Kinder schaukeln 72 Rio real und rutschen. Seit man hier nicht mehr um sein Leben fürchten muss und sogar Besucher von außen kommen, versuchen viele Bewohner ihr Glück mit kleinen Geschäften. In der lavanderia, der »Wäscherei«, gebe ich meine schmutzige Kleidung ab. Die nette Besitzerin fragt mich nach meinem Namen und stellt sich selbst als Daluz vor.
Überallhin muss ich weniger als hundert Meter laufen, ich fühle mich tatsächlich wie in einem kleinen Dorf, aber mit gutem Service und ohne Spießigkeit. In der padaria, der »Bäckerei«, verkaufen ab sechs Uhr morgens zwei Schwestern frische, warme Brötchen. Kleine Shops, in Deutschland würde man sie als Tante-Emma-Läden bezeichnen, bieten alles von Thunfisch im eigenen Saft bis zu Spray gegen Riesenkakerlaken. Ach so, die Riesenkakerlaken. Ihre Leichen liegen auch im teuren Ipanema auf der Straße, und ich kenne sie schon aus New York und Hongkong. Es sind intelligente Tierchen, ich dränge sie in die Enge, und sie rennen durch den Türschlitz aus der Wohnung. Aber nach einigen Tagen entscheide ich mich dann doch für die chemische Keule. Von da an besuchen sie mich nicht mehr. Wirkt das »Gleichgewicht des Schreckens«? Oder haben sie einfach gemerkt, es gibt hier nichts zu fressen, seit die Wohnung wieder bewohnt und sauber ist?
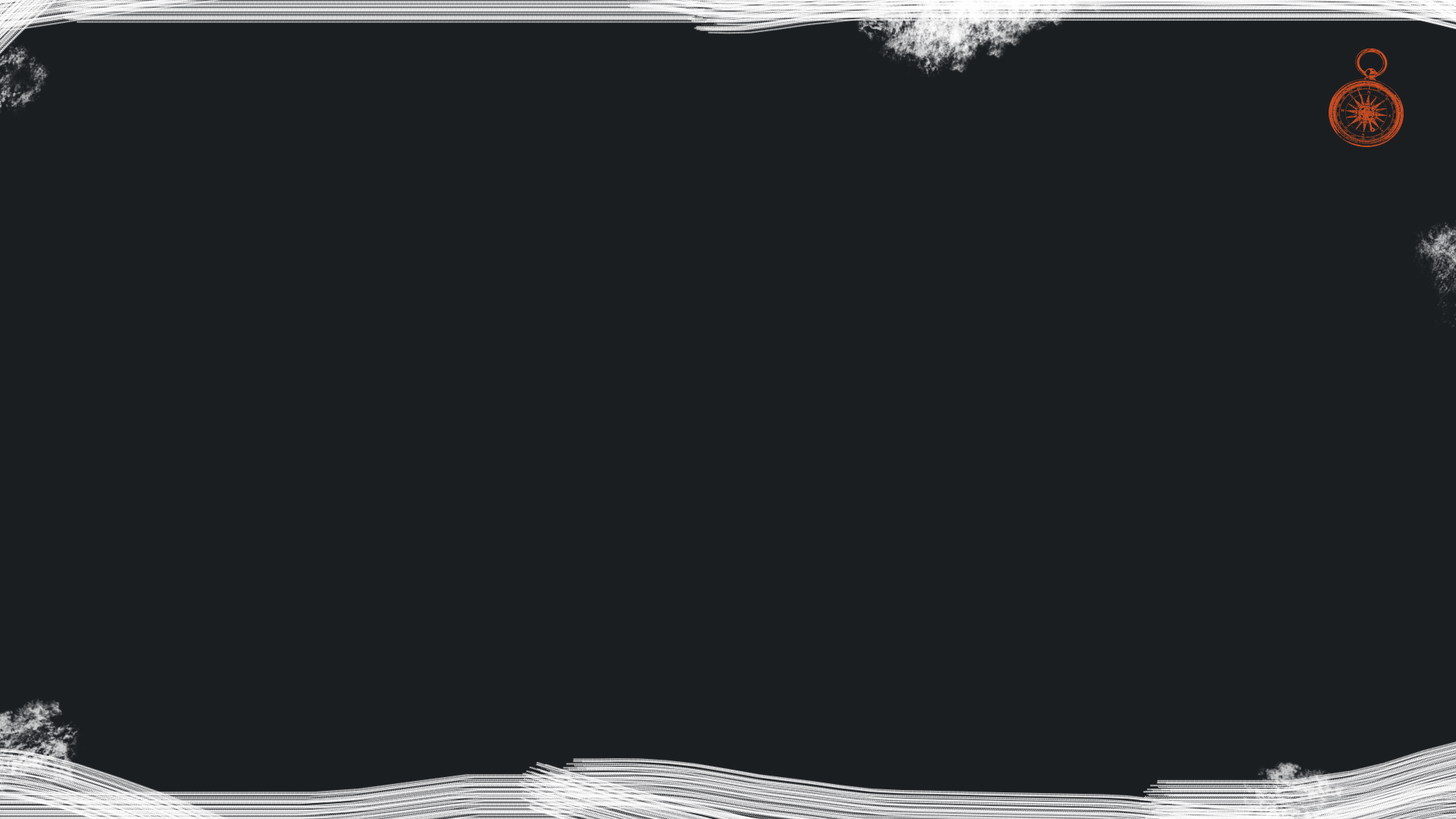
Der Autor
Adrian Geiges ist ein international bekannter Autor und Filmemacher. Er hat jahrelang als Auslandskorrespondent in Peking, Moskau, Hongkong, New York und Rio de Janeiro gearbeitet, zahlreiche Beiträge in stern, Die Zeit, Spiegel TV, ARD etc. veröffentlicht, spricht fließend Chinesisch, Russisch und Englisch. Seine Bücher wurden in viele Sprachen übersetzt.
Seine internationalen Erfahrungen bringt Adrian Geiges nunmehr als Chefredakteur bei BISSINGER[+] ein. Dort leitet er unter anderem die Redaktion des Evonik-Magazins. Die Hamburger Medienagentur wurde 2013 von Manfred Bissinger gegründet, dem langjährigen stellvertretenden Chefredakteur des stern und Chefredakteur von Merian, Natur und Die Woche.
Die Energie für den Herd kommt hier nicht von einem Konzern wie E.ON oder RWE. Ein Mann schiebt mit Handwagen eine Gasflasche durch die Gassen und ruft im monotonen Takt »Alugas!«, die Abkürzung für Gasflasche aus Aluminium. Auf Zuruf verkauft er das Gas und montiert die Behälter auch, wenn er darum gebeten wird. Die kurvige Bergstraße, die von meiner Favela in die City führt, endet nahe dem mir schon gut bekannten Largo do Machado. Bergab und bergauf brauche ich zu Fuß jeweils gut 20 Minuten. Das erspart die Kosten für ein Fitnessstudio. Es fährt aber auch ein Kleinbus, der immer dann startet, wenn er voll ist – das Prinzip kenne ich aus China. Am schnellsten geht es mit einem der MotorRio real 73 radtaxis, die oben und unten auf Kunden warten. Man bekommt einen Helm und muss sich angesichts des schmalen, steilen Weges gut an den Haltegriffen festhalten. Die Straße ist gepflastert, die Kurven sind scharf. Und die Motorradtaxifahrer schneiden sie noch schärfer, wobei sie bei entgegenkommenden Autos spontan entscheiden, ob sie rechts oder links an ihnen vorbeifahren. Manchmal rasen die Motorradfahrer um die Wette. Oft taucht plötzlich ein anderer Motorradfahrer oder ein Auto in der Gegenrichtung auf. Das Risiko eines Unfalls ist hier sicherlich noch größer als die Gefahr, in Rio Opfer eines Verbrechens zu werden. Als lebende Mahnung sitzt einer der Fahrer auf den Wartesitzen unten am Berg mit einem Gips vom Fuß bis zum Oberschenkel. Aber mit den Motorradtaxis zu fahren bringt Spaß, eine Achterbahn fühlt sich im Vergleich dazu an wie ein Kinderkarussell. Der warme Wind streichelt mich, ich atme frische Luft ein, der blaue Himmel blickt von oben auf mich herunter. Ich denke an den Dauerregen in Hamburg. Und obwohl ich nicht vorhabe, mich in absehbarer Zeit zu verabschieden, scheint mir fast: Wenn man schon einmal sterben muss, dann gehört ein Ende in so einem Augenblick sicher zu den schöneren Varianten – allerdings nur, wenn man sofort tot ist. Wenn die Motorradchauffeure bergab rollen, lassen sie den Motor nicht laufen, deshalb kostet die Fahrt umgerechnet auch nur 35 Cent. Bergauf verlangen sie das Zweieinhalbfache davon. Die Betreiber der Kleinbusse haben diese Preise einfach übernommen.
Am nächsten Nachmittag hole ich meine Klamotten in der Wäscherei ab. Ein Junge sitzt da, er weiß zunächst nichts mit mir anzufangen. Daluz ruft aus der Waschküche: »Das ist Adrian, sein Kleidersack liegt unten links.« Auch meine Nachbarn, zumeist Rentnerinnen, haben mich schon persönlich begrüßt. Hier kennt jeder jeden. Deshalb lebe ich hier viel sicherer als in den anonymen Hochhäusern von Copacabana und Ipanema, wo Touristen und ausländische Fachkräfte Freiwild für Räuber sind – eine Einschätzung, die mir später viele Cariocas innerhalb und außerhalb der Favela bestätigen werden. An meiner Wohnungstür wartet ein freundlicher junger Mann in Uniform auf mich. Er stellt sich als Vertreter von Net vor, einem Kabelfernsehanbieter. Er möchte mich als Kunden gewinnen. »Das wird jetzt alles legalisiert«, erklärt er mir. Auch das zeugt davon, wie sich die Favelas verändern. Früher wurde das Kabelnetz »auf den Hügeln« einfach angezapft. Ich merke: Hier spreche ich viel mehr Portugiesisch als unten in der City. Wer unterhält sich schon mit den Kassiererinnen in einem Supermarkt oder mit dem Aufsichtspersonal der U-Bahn?
Überrascht bin ich, als mich ein junger Nachbar, Adriano, nahezu fließend auf Deutsch anspricht. Wie sich herausstellt, ist die Mutter seiner Freundin Stephanie Deutsche, sie selbst hat in Österreich studiert. Adriano ist hier aufgewachsen, Stephanie zog vor zwei Jahren wegen der günstigen Mieten und der Sicherheit hierher, sie haben sich in der Favela kennengelernt. Beide jobben bei Bobs Jazzfesten. Am Abend verdient Adriano Geld als Motorradtaxifahrer, tagsüber studiert er Management. Nach dem Abschluss möchte er ein Internetunternehmen gründen. Eine ganz neue Schicht wächst in den Favelas heran. Ich spreche Adriano auf die Ansicht des Ethnologie-Professors Guilherme Werlang an, wonach »nur Gringos in den Favelas wohnen« (eine, statistisch gesehen, mehr als absurde Behauptung, aber er wollte wohl sagen: Nur ihr zieht freiwillig dorthin). Adriano schmunzelt und winkt ab: »Das ist die Arroganz unserer weißen Oberschicht. Ihre Angehörigen ekeln sich vor den Favelas, und sie können sich nicht vorstellen, wie man hier leben kann.«
Eine ganz andere Seite von Rios Realität erlebe ich ein paar Tage später: Bisher nutze ich das WLAN in Bobs Guesthouse, doch dringend brauche ich meinen eigenen Telefon- und Internetanschluss zu Hause, um nicht mehr zwischen Hotelgästen und Bobs Hund und Katzen arbeiten zu müssen. Meine Steuernummer CPF habe ich schon, da sollte es kein Problem sein, einen Vertrag abzuschließen – meint auch Bobs Frau Marluce und ruft für mich im Callcenter der Telefongesellschaft an. Die trägt den passenden Namen Oi, »Hallo«. Sie konkurriert in Brasilien mit anderen, kann aber als Einzige in unserer Favela eine Telefonleitung legen. Meine CPF wird vom Computer sofort als die eines Ausländers erkannt. Und da, so will es die Vorschrift, kann man den Anschluss nicht am Telefon bestellen, ich muss mit Reisepass und dem Original der CPF in einem Servicecenter von Oi vorsprechen. Es liegt im Centro von Rio, wo Businessleute an Bettlern vorbeieilen, Bürotürme über den Kaiserpalast und verfallende Gebäude ragen und wo im Park die capivaras, »Wasserschweine«, Gras fressen. Sie sind mit bis zu 130 Zentimetern Länge die größten Nagetiere der Welt. Im »Servicecenter« sind jeweils nur zwei bis drei von den zehn Beraterplätzen besetzt. Weitere Mitarbeiter gehen durch den Raum, flirten mit ihren Kolleginnen, massieren deren Nacken und schauen ihnen bei der Arbeit zu. Sind das Abteilungsleiter? Oder Praktikanten? Es drängen sich hundert Kunden, von denen nur einige einen Sitzplatz finden, während andere wie ich stehen – drei Stunden, so lange dauert die Wartezeit. Die meisten Kunden beschweren sich über einen Kostenpunkt auf ihrer Rechnung oder über schlechten Empfang. Jeder hat am Eingang eine Wartenummer sowie Werbung für ein Zusatzangebot an Kabel-TV-Sendern mit Sex-Programmen für umgerechnet fünf Euro bekommen. Zweimal kommt es zu Tumulten zwischen Besuchern und Personal, weil angeblich jemand aus der Schlange vorgezogen wurde, andere Wartende halten ihre aufgebrachten Leidensgenossen von Handgreiflichkeiten ab.
Als ich endlich dran bin, verstehe ich, warum jedes Gespräch so lange dauert. Die Beraterinnen müssen am Computer eine vorgegebene Liste von Punkten abarbeiten, die großenteils für die Telefonleitung nicht relevant sind (zum Beispiel der Name der Mutter und der Ehestand) und die in meinem Fall in der Frage gipfeln: »Kommen Sie aus Ost- oder aus Westdeutschland?«
Um die Beratungszeit zu verdoppeln, hat sich ein Kontrollfreak folgendes Verfahren ausgedacht: Nachdem die Beraterin Adresse, familiäre Verhältnisse und andere lebenswichtige Angaben in den Computer eingegeben hat, wird eine Vorgesetzte angerufen, die den Kunden dann alles noch einmal fragt und die Antworten mit dem abgleicht, was ihre Kollegin in den Computer getippt hat. Ich hake das für mich als wunderbare Portugiesischübung ab. Innerhalb der nächsten sieben Tage kommen Techniker bei mir vorbei, die sich vorher auf meinem Handy melden, um den Anschluss für Internet und Festnetztelefon zu legen. So heißt es. Das Leben in einer Favela wäre nichts für deutsche Rentner mit gutem Gehör, die schon gegen Kindertagesstätten in ihrem Wohngebiet klagen, weil sie sich dadurch in ihrer Ruhe gestört fühlen. Den Kauf einer Musikanlage kann ich mir getrost sparen, die der Nachbarn sind voll aufgedreht, und ich kann mithören: von Bossa Nova bis Funk, die ganze Breite der brasilianischen Musik, dazwischen internationale Stars wie Rihanna oder Lionel Richie. Manche Bewohner tragen sogar ihren lauten Gettoblaster, der hier seinem Namen voll gerecht wird, mit durch die Favela, wohl aus Angst davor, versehentlich in eine Ruhezone zu geraten. Im Prozess der Evolution hat sich die Lautstärke vieler Stimmen an den Geräuschpegel der Musik angepasst.
Später werde ich tatsächlich einmal einen Rentner aus der Heimat zu Besuch haben, der zwar zehn Jahre in Brasilien gelebt hat und fließend Portugiesisch spricht, aber sehr deutsch geblieben ist. Er fragt mich allen Ernstes: »Gibt es hier keine Regelung, wann die Musik abends ausgemacht werden muss?« Was für ein europäischer Gedanke! Was für eine deutsche Frage! Auch in China und in Russland hielt ich mich an den Grundsatz: Wer in Rom lebt, muss wie ein Römer leben. Leider habe ich viele Landsleute, die zwar gern durch die Welt reisen oder woanders arbeiten, wenn ihnen dafür eine Auslandszulage gezahlt wird, die es aber am liebsten überall so haben wollen wie in Deutschland.
Noch lauter wird es in meiner Favela samstags, wenn auf dem Sportplatz eine Party gefeiert wird. Der DJ schreit über den Platz, als würden seine Lautsprecher nicht funktionieren – aber sie funktionieren sehr gut. Die Frauen haben sich grell bemalt, tragen Miniröcke oder Hotpants und kreisen ihre Hintern zu den Rhythmen, in der Hand halten sie Plastikbecher mit Bier oder Wodka.
Die meisten Männer, in T-Shirts und Bermudashorts und manchmal mit Baseballkappe, schauen zu und halten Reden, strecken ihre erhobenen Daumen in alle Richtungen, um Freunde und Bekannte zu begrüßen. Alle paar Hauseingänge stößt man in der Favela auf eine boteco, einfache Eckkneipen, die oft in die Häuser eingebaut sind, nach außen offen, klein wie eine halbe Garage, darin eine Theke und ein paar Plastiktische und -stühle. Manchmal sitzen nur zwei, drei Leute dort beim Bier, von denen einer der Wirt ist. An einem Wochenende eröffnet eine neue boteco, die Gäste stehen dicht gedrängt wie in der U-Bahn am Feierabend, auch noch weit in die Gasse vor der Kneipe hinein. Batista, der Wirt einer anderen boteco, begrüßt mich mit ausgestreckter Hand und erhobenem Daumen und winkt mich zu sich. Warum ich hier sei und nicht in seiner Bar? Ist die überhaupt offen, wenn er selbst hier ist und die Konkurrenz beobachtet? Ich verspreche, das nächste Mal zu ihm zu kommen. Er sagt, bei ihm seien immer muitos mulheres, »viele Frauen«. Jetzt habe ich endlich meinen Termin bei der Polícia Federal, deren Abteilung am Internationalen Flughafen die Rolle einer Einwanderungsbehörde übernimmt. Hier soll mein Visum für vier Jahre in eine Aufenthaltsgenehmigung für vier Jahre umgewandelt werden. Ich habe alle Papiere beisammen, die Gebühren bezahlt, zwei Passfotos in der vorgeschriebenen Größe mitgebracht. Abdrücke von allen Fingern werden genommen, weitere Fotos von mir gemacht. Etwas fühle ich mich wie ein Verbrecher nach seiner Verhaftung, aber brasilianische Freunde erzählen mir später, so etwas sei hier üblich, auch für die eigenen Bürger. Der Beamte prüft alles gründlich. Als er auf meine Adresse stößt, blafft er mich plötzlich an: »Sie leben in einem Slum!« Zuerst verstehe ich ihn nicht richtig, bitte ihn, das zu wiederholen. »Sie leben in einem Slum!« »Ach so«, schmunzele ich, »Sie haben an der Adresse erkannt, dass ich in einer Favela lebe.« »Sage ich doch, in einem Slum. Wie soll ich das sonst bezeichnen?« »Nun, Ihre Regierung nennt die Favelas mittlerweile comunidade, ›Gemeinschaft‹.« »Trotzdem sind das arme Leute, schlechte Häuser.« »Doch es ändert sich einiges.« »Ich glaube nicht daran.« Der Beamte ist über fünfzig Jahre alt, wurde noch zu Zeiten der Militärdiktatur (1964–1985) eingestellt. Seine Vorurteile sind typisch für Angehörige der »besseren Gesellschaft« in Brasilien. Ich bin wütend. Schließlich weiß ich: Die meisten meiner Mitbewohner aus der Favela gehen früher als ich aus dem Haus, um in der City zu arbeiten. Wenn sie gleichzeitig mit mir im Kleinbus nach unten fahren, sehe ich, wie viel besser als ich sie gekleidet sind, wie besonders die Frauen sich gepflegt und geschminkt haben. Sie wollen ihr Leben verändern und teilen nicht den Zynismus des Staatsbeamten. Trotzdem stempelt er meinen Pass ab – und genehmigt mir einen
Aufenthalt bis zum 29. März 2017. Es stürmt, Wassermassen prasseln so stark, wie es selbst alteingesessene Bewohner von Rio schon lange nicht mehr erlebt haben. Es ist früh morgens, als plötzlich der Strom ausfällt. Später stürzen auch noch Bretter vom Hausdach gegenüber, direkt auf die Leitungen vor meinem Fenster. Bei dem Kabelsalat in der Favela fürchte ich: Es wird Tage dauern, bis der Defekt gefunden und behoben ist. Ich schalte meinen Computer an, natürlich: Auch das WLAN der Nachbarn funktioniert nicht mehr. In einem dichten Regenanzug, den ich mir einmal für eine Reportage über einen Wirbelsturm in den USA gekauft habe, gehe ich zu meiner Bäckerei. Sie ist mit Kerzen beleuchtet. Ich kehre zurück, kein heißer Kaffee, da der Maschine der Strom fehlt, Käse und Thunfisch drohen im ungekühlten Kühlschrank zu verderben, keine warme Dusche, denn das Wasser wird elektrisch erhitzt. Wie lange soll das dauern? Kann ich hier unter solchen Bedingungen arbeiten?
Als ich mittags aus dem Portugiesischunterricht komme, leuchten in meiner Wohnung die Lampen, die ich am Morgen angestellt habe. Alle Probleme sind behoben. Mein Nachbar Bruno sagt: »Noch vor ein paar Jahren blieben wir in solchen Fällen manchmal einen ganzen Tag ohne Strom. Jetzt wird die Ursache des Ausfalls fix entdeckt.« Abends ruft mich Florian an, ein deutscher Kameramann, der im Künstlerviertel Santa Teresa lebt, in dem doch angeblich keine Gringos wohnen. Wir wollen uns ein paar Tage später in einem Restaurant treffen, ich bitte ihn, mir die Adresse per E-Mail zu schicken. Nein, das gehe im Moment nicht, sagt er: »Wegen des Sturms haben wir noch keinen Strom.« Innerhalb von einer Woche sollte mein Festnetz- und Internetanschluss gelegt werden. Doch es sind schon drei Wochen vergangen, und außer einem kurzen Anruf des Callcenters der Telefongesellschaft Oi auf meinem Handy, bei dem nach einer Minute die Verbindung unterbrochen war, ist bisher nichts passiert. Fürs Internet nutze ich mittlerweile das WLAN meines Nachbarn, da sind Brasilianer flexibler als Deutsche. Kommunikation kostet viel in Brasilien. Für Festnetz und Internet soll ich laut dem Vertrag, den ich abgeschlossen habe, umgerechnet 42 Euro im Monat bezahlen, ohne Handyanschluss und ohne irgendeine Telefonflatrate. Das bringt mich auf die Frage: Brauche ich diesen Anschluss überhaupt? Zwar kann ich nicht mit dem Handy allein leben, denn das hat auf dem Berg kaum Empfang, auch ein verbreitetes Problem hierzulande. Aber bei Skype kaufe ich mir für ein paar Euro eine brasilianische Festnetznummer, über die mich Leute erreichen können, die selbst kein Skype haben – und zusätzlich eine weltweite Flatrate für unbegrenzte Anrufe in Festnetze von Brasilien bis Deutschland, nach China sogar einschließlich Anrufen auf Handys. Auch in Brasilien haben die Dinosaurier, die alten Telefonmonopolisten, keine Chance gegen die Konkurrenz aus dem Internet.
Überhaupt scheint mir dies das ultimative Sparkonzept zu sein: in einer Favela leben und den Telefonanschluss durch Skype ersetzen. Das erste Mal besuche ich Massa, den Friseur in der Favela. Zum Glück ist mein Portugiesisch mittlerweile gut genug, um einen corte de cabelo zu verlangen, einen »Haarschnitt«, und nicht einen corte de cabeça, das wäre das »Abschneiden des Kopfes«. Trotzdem bin ich beunruhigt: Der Friseur und die Kunden vor mir tragen, wie die meisten Männer in der Favela, ihr Haar sehr kurz geschoren. Bei aller Bereitschaft zur Integration: So möchte ich nicht aussehen. Tatsächlich erweist sich das Schneiden als Abenteuer. Meine Haare scheinen für Massa gar nicht zu existieren, er starrt ständig auf den Fernseher, wo die Sendung Cidade Alerta läuft, wörtlich »Wachsame Stadt«. Hier wird nicht nur, wie in Aktenzeichen XY …ungelöst, über Kriminalität gesprochen – hier wird sie gleich live gezeigt. Gerade beobachtet ein Hubschrauber der Fernsehsendung eine Verfolgungsjagd auf den Straßen São Paulos. Eingeblendet ist: »Schon zwei Schießereien innerhalb von fünf Minuten.« Dazwischen nimmt Massa auf seinen beiden Handys Gespräche an, manchmal gleichzeitig. Dann wieder rennt er zur Kasse, wenn das Telefon dort klingelt. Immer scheint es um irgendwelche Geschäfte zu gehen, der Friseur nennt höhere Geldbeträge. Mein Haarschnitt kostet nur 10 Reais, umgerechnet 3,80 Euro.
Gerade habe ich meine Mutter am Telefon wieder einmal besänftigt, wie sicher es hier ist, da bringe ich meine Mülltüte zum Container – und ein Polizist richtet sein Gewehr auf mich! Hinter ihm stehen drei martialisch blickende Kollegen. Nein, man stelle sich hier keine deutschen Streifenpolizisten vor, eher US-Soldaten im Irak: Die Polizisten tragen Stahlhelme, kugelsichere Westen und schwarze Uniformen, was sie noch bedrohlicher aussehen lässt. Und auf mich zielt keine einfache Pistole, sondern eine über einen Meter lange Pumpgun, mit denen US-Marines in Kriegen verbarrikadierte Türen aufbrechen. Bevor ich wirklich Angst bekomme, denke ich mir, was mir später mein Vermieter Bob bestätigt: Ich erlebe eine Kampfübung des Bataillons für spezielle Polizeioperationen BOPE, das uns hier bewacht. Die Elitepolizisten trainieren, wie sie andere Favelas erobern können, die noch von den Drogenbanden beherrscht werden. Bob sagt: »Dort sind die Gassen ähnlich eng – aber anders als hier wird da auf sie geschossen.«
Obwohl es nur eine Übung ist – hoffentlich hält sich der Polizist der Sondereinheit an den Spruch meines Vaters, der einen Waffenschein besaß: Richte nie ein geladenes Gewehr auf einen Menschen. Abends sitzen die Elitepolizisten in schwarzen T-Shirts, auf denen der Name ihrer Einheit aufgedruckt ist, in den kleinen Bars unserer Favela mit Einwohnern beim Bier. Eine junge Kneipenwirtin hat sogar ein Mitglied dieser Tropa de Elite geheiratet. So eng ist das Verhältnis nicht überall, wo bewaffnete Kräfte Favelas »befriedet« haben, weiß ich aus meinen Gesprächen an Orten, die ich mit Nanko besucht habe. Ich spreche Bob darauf an. »Ach, das hängt davon ab, wen man fragt«, winkt er ab. »Wenn die Polizisten kommen, äußern sich die Bewohner kritisch über die Befriedung – aus Angst vor den Drogengangstern. Sobald diese weg sind, freuen sie sich aber, weil sie keine Angst mehr um ihr Leben haben müssen.«

